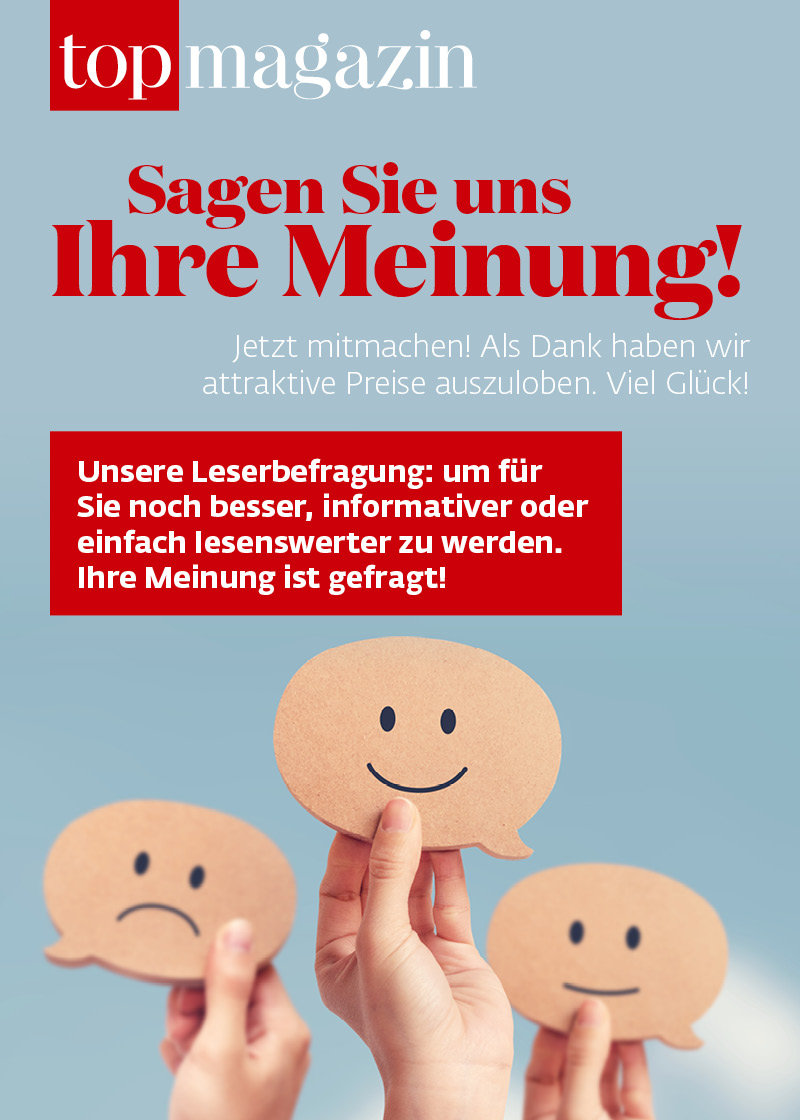Daniel Boden Insights
September 2025

Daniel Boden Insights September 2025
Daniel Boden, Unternehmer aus Essen, ist als Berater und Investor viel im Ruhrgebiet unterwegs und berichtet für das TOP RUHR über Events und Menschen aus unserer bunten Ruhrmetropole. Leserbriefe an: info@bbi.one
STADTGESPRÄCHE.Ruhr mit Sigmar Gabriel in der S-ART Galerie
Wenn Stadtgespräche zum Kunstwerk werden, liegt das auch an Orten wie der Galerie S-ART, einer der größten Privatgalerien Deutschlands in Essen. Zwischen großformatiger Kunst, kreativer Lichtregie und herzlicher Gastgeberkultur des Kunst- und Architektenpaares Sharyar und Azadhe Azhdari, versammelt sich die Essener Gesellschaft zum 33. Mal.

Das Thema: „Europas Zukunft in einer zunehmend instabilen Welt“. Im Mittelpunkt des Abends: Sigmar Gabriel, Ex-Außenminister und SPD-Schwergewicht, im Gespräch mit Moderator Jürgen Zurheide. Gastgeber Sharyar Azhdari hat eigens für Gabriel eine persönliche Collage gestaltet – ein Geschenk mit Symbolkraft, das Politik und Kunst sichtbar verbindet. Lockerer Einstieg, ernster Inhalt – etwa als Gabriel auf die Frage, was er als Kanzler zum Treffen mit dem „Unaussprechlichen“ nach Washington mitbringen würde, auf ein Gemälde von Donald Duck zeigt. Es wird aber deutlich

ernster: Gabriel spricht offen über seine Erfahrungen mit Wladimir Putin, über den Zustand des Westens – und darüber, wie nah Krieg und Frieden wieder an Europa herangerückt sind. Gabriels klare Worte über Putins Strategie, Trumps unberechenbare Politik und Europas sicherheitspolitische Lage lassen das Publikum vor Aufmerksamkeit verstummen. Besonders eindrücklich: Sein Kipppunkt in der Beziehung zu Putin, als dieser im Syrien-Krieg Zivilisten bewusst ignorierte. „Wenn man Krieg führt, muss man ihn auch gewinnen wollen“ – das war Putins zynische Antwort und Gabriels Wendepunkt.

Das Rahmenprogramm gestalten musikalisch Shiela Tan und Peter Köcke. Und Gastgeberin Azadeh Azhdari stellt mit dem Buffet unter Beweis, dass sie nicht nur eine ausgezeichnete Architektin, sondern auch eine hervorragende Köchin ist. Insgesamt ein Abend, der politische Ernsthaftigkeit mit kulturellem Stil verbindet – und erneut zeigt, wie Stadtgespräche.ruhr Diskurs, Haltung und Heimatbewusstsein auf ganz eigene Weise zusammenführt.
Nelson Müllers großer Wurf – nun auch Hotelier in Bergisch Gladbach
Es gibt Termine, die will man nicht verpassen – und doch zwingt einen das Leben manchmal zur Pause. Krankheitsbedingt muss ich bei der Eröffnung von Nelson Müllers Diepeschrather Mühle passen. Doch zum Glück sind Freunde und Wegbegleiter vor Ort und schildern mir später begeistert, was ich versäumt habe. Mit dem neuen „Relais & Châteaux Hotel Diepeschrather Mühle“ erfüllt sich Nelson einen lang gehegten Traum.

Seit Jahren ist der Sternekoch eine feste Größe im Ruhrgebiet – nun wird er auch zum stilprägenden Hotelier in Bergisch Gladbach. Soul-Sängerin Cassandra Steen, Schauspieler Henning Baum, Comedians wie Matze Knop und Guido Cantz sowie der Galerist und Kunstexperte des TV-Formates „Bares-für-Rares“ Colmar Schulte-Golz und ebenso Torwartlegende Toni Schumacher gratulieren Nelson zu diesem besonderen Moment.

Müller, Babette Albrecht und Colmar
Schulte-Golz (Bares-für-Rares-Experte)
Auch Unternehmerin Babette Albrecht ist beeindruckt: „Natürlich kenne ich Nelson und sein hohes Niveau, aber er hat es mal wieder geschafft, mich zu überraschen. Der ganze Abend war perfekt organisiert – an einem wunderschön inszenierten Ort mit toller Atmosphäre und kulinarischen Zutaten, wie sie nur

Nelson kombinieren kann. Und auch, wenn das Gourmetrestaurant Schote aus Essen nach Bergisch-Gladbach umgezogen ist, steht Nelson

Müller zu seiner Homebase: Die Brasserie MÜLLERS auf der Rü in Essen bleibt fester Bestandteil seiner Genusswelt. Ein wichtiges Signal für den Ruhrpott – und für alle, die Nelsons Küche auch weiterhin mitten im Revier erleben wollen.
Mit Volldampf ins Designuniversum zum Red Dot Award
Auf der Zeche Zollverein trifft sich die internationale Designszene zum Red Dot Design Award 2025, und ich bin mittendrin dabei. Menschen aus aller Welt – Designer:innen, Unternehmer:innen und Kreativköpfe – diskutieren, fotografieren und philosophieren über Produkte, die in die Zukunft weisen. Meine besondere

Aufmerksamkeit gilt meiner Leidenschaft für Mobilität. Da steht er: der Lamborghini Revuelto – ein Hybrid-Supersportwagen mit kantiger Dramatik, als hätte ein Sturm sich in Karbon gegossen. Mitja Borkert, seit 2016 Chefdesigner der Sportmarke, erläutert mir die wesentlichen Designelemente.

Ziemlich beeindruckt schlendere ich aus der Halle und stoße auf ein elektrisches Motorrad. Es scheint den Weg in die Zukunft zu zeichnen: Die kanadische Marke Can-Am zeigt seine Pulse ’73 des Unternehmens BRP (Bombardier Recreational Poducts).

Minimalistisches Design, neu gedacht – radikal, effizient und mutig verspricht es urbanen Fahrspaß. BRP wird völlig zu Recht zum „Designteam des Jahres“ gekürt. Ich treffe den Design-Chef von Can-Am, Denys Lapointe, der mir erläutert, wie aus ei-ner Vision eine innovative Marke für Freizeitmobilität entstanden ist. Dazu ein Highlight für Menschen, die auch mobil die Freiheit erkunden, dabei aber auf ihren gewohnten Luxus nicht verzichten möchten: Der Brabus Big Boy 1200 ein gewaltiges Luxuswohnmobil. Glamping bezeichnet die Kombination aus „glamourös“ und „Camping“, die hier wortwörtlich ins Schwarze trifft.

Im Aalto-Theater folgt abends die Preisverleihung für die „Best of the Best“ mit dem Initiator Prof. Dr. Peter Zec und einer Begrüßung durch Essens OB Thomas Kufen. Die Auszeichnung „Best of the Best“ wird Produkten

gewidmet, die durch Innovationskraft, gestalterische Präzision und funktionale Exzellenz überzeugen. Nach der Verleihung feierte die bunte und internationale Design-Gesellschaft, wie jedes Jahr auf Zeche Zollverein, bis in die frühen Morgenstunden.
Carolinenhof feiert Sommerfest – Reiten als Therapie mit Schirmherrin Isabell Werth

Ich hatte schon viel über den Carolinenhof gehört, der im Stillen Großes leistet. Babette Albrecht, seit Jahren Unterstützerin des Vereins, macht mich darauf aufmerksam. Schon bei der Anfahrt nach Essen-Kettwig, wo sich Stadtgrenzen in grüne Weiten auflösen, wird klar, welche Dimension das Projekt inzwischen erreicht hat. Vor Ort riecht es nach Heu, irgendwo wiehert ein Pferd. Pünktlich zur Rede von Gründer Carsten Knauer bahnen wir uns den Weg zur Zuhörerschaft. Er erklärt, wie auf dem Carolinenhof – mittlerweile größte Einrichtung ihrer Art in Deutschland – Reitsport, Therapie und Inklusion wirkungsvoll zusammenkommen. Was Carsten und Sabine Knauer mit ihrem Team aufgebaut haben, ist kein gewöhnlicher Reiterhof, sondern ein geschützter Raum für Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen – zugleich ein offenes Haus für alle Pferdefreunde. Über 500 Gäste besuchen das Sommerfest. Mittendrin: Isabell Werth. Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt ist Schirmherrin des Hofes. „Es ist beeindruckend, was Pferde bewirken können. Ich sehe es in den Gesichtern der Kinder, die auf dem Rücken dieser sanften Tiere strahlen.“ Auch FUNKE-Verlegerin Julia Becker ist vor Ort – ihre Spende finanziert ein Therapiepferd für ein ganzes Jahr. Oberbürgermeister Thomas Kufen betont die Bedeutung des spendenfinanzierten Projekts.
Klavier-Festival Ruhr Abschlusskonzert mit Starpianist Igor Levit
Zum Abschlusskonzert des Klavier-Festivals Ruhr 2025 reise ich nach Wuppertal. Der letzte Abend einer eindrucksvollen Saison findet in der prachtvollen historischen Stadthalle statt. Auf dem Programm: Beethoven.

Auf der Bühne: Starpianist Igor Levit gemeinsam mit Alexandre Kantorow, Alexander Sitkovetsky, Lawrence Power und Victor Julien-Laferrière, die mit ihren Streichinstrumenten begleiten. Vom ersten Ton an entsteht ein intensiver Dialog – Levit spielt präzise, nuancenreich und voller Spannung, das Ensemble antwortet mit feiner Balance und Leichtigkeit. Ein Zusammenspiel auf höchstem Niveau. Nach dem letzten Ton reißt es das Publikum aus den Sitzen. Die Standing Ovation für die Virtuosität der Künstler wird mit einer Zugabe belohnt. Nach dem Konzert lädt Intendantin Katrin Zagrosek in die Lounge. In exklusiver Runde dankt sie Künstlern, Sponsoren und ihrem Team. Der Abend klingt in angenehmer Atmosphäre und mit guten Gesprächen aus. Die Festival-Saison 2025 ist mit über
39000 Besucher*innen ein Post-Corona-Rekord. Doch nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und die Chancen stehen gut, dass 2026 die Schwelle von 40000 überschritten wird.
„DER LETZTE BULLE“ HINTER DEN KULISSEN
EIN DREHTAG IN ESSEN
Meine Neugier ist sofort geweckt, als ich erfahre, dass mein alter Freund Henning Baum mal wieder in Essen ist. Dreharbeiten für „Der letzte Bulle“ – spannend: Wie wäre es, einmal hinter die Kulissen zu blicken, live vor Ort zu sein, wenn Fernsehen entsteht? Ich mache mich auf den Weg in die Essener Innenstadt. Erste Station: ein Parkhaus, teilweise abgesperrt, Polizeiwagen stehen bereit.

Der Ort wirkt düster, ein „dunkles Loch“ – perfekt für eine Szene mit kriminellem Hintergrund. Nächste Station: Es geht auf „die Rampe“ zwischen den Hotels Handelshof und Essener Hof. Hier soll ein Gespräch zwischen Mick Brisgau, also Henning, und seinem Partner, Andreas Kringge, gespielt von Maximilian Grill, stattfinden. Absperrungen halten Passanten fern. Techniker ziehen ihre mobilen Wägelchen mit Kabeln und Geräten, Mikrofone mit Windschutz-Fell hängen an langen Stangen. „Handys aus – Ruhe am Set!“ ruft der Regisseur. „Und … Action!“ Die Szene wird mehrmals gedreht. Der Regisseur erklärt mir, dass dieser ganze Drehtag am Ende vielleicht fünf bis zehn Minuten der neuen Staffel von „Der letzte Bulle“ ergeben wird. Ein enormer Aufwand für einen kleinen Ausschnitt.
Danach wird’s physisch, die dritte Szene steht an: eine Schlägerei. Es ist inzwischen dunkel. Eine Matte wird ausgebreitet, Warmmachen ist angesagt. Dann nimmt jeder seine Position ein. Und: „Action!“ Mick Brisgau kommt aus der U-Bahn-Station und hört einen Straßenmusiker, der auf seiner Gitarre „Forever Young“ spielt. Ein Gänsehautmoment – ich bin mir sicher, Henning hat dieses Lied selbst ausgesucht. Es erinnert mich an unsere Jugend. Mick bleibt stehen und lauscht, als plötzlich drei Rowdies den Musiker attackieren. Mick schaltet zwei der Angreifer in einer wilden Schlägerei aus, der dritte zieht ein Messer. Kein Problem für den „Bullen“: Er entwaffnet auch ihn, bringt ihn mit einem gezielten Hebelwurf zum Liegen. Gedreht wird die Szene aus zwei Perspektiven, zig Wiederholungen für das optimale Ergebnis. Mir wird klar, wie professionell und zugleich fordernd diese Arbeit ist – für Schauspieler wie für die Crew. Das braucht mal eine Pause. Etwas entfernt, in einer Seitenstraße, ist die sogenannte „Base“. Hier reihen sich Lkws mit Technik, Foodtruck, Kabinen für Schauspieler, Toiletten – alles, was ein Set braucht. Ein enormer Aufwand, der dem Publikum abends vor dem Fernseher gar nicht bewusst ist, wird mir klar. Gegen 22 Uhr verabschiede ich mich. Für Henning und das Team aber geht der Drehabend immer noch weiter.
VON DER KOHLE ZUR KI – NRW HAT WANDEL IM BLUT
Auf Einladung von Arndt Hüsges, Inhaber der Hüsges Gutachtergruppe und Mitglied des Digitalbeirats von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, nehme ich an der Zukunftskonferenz „Von der Kohle zur KI“ in Berlin teil. Arndt steht für einen Mittelstand, der nicht nur über Digitalisierung spricht, sondern sie mit digitalen Gutachten und KI-gestützten Fahrzeugscannern aktiv mitgestaltet – diese Praxiserfahrung bringt er in die politische Debatte ein. Die Konferenz ist hochkarätig besetzt und einem ausgewählten Kreis vorbehalten.

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Start-ups kommen hier zusammen, um die Potenziale von Künstlicher Intelligenz zu beleuchten und konkrete Perspektiven zu schaffen. Mit dabei der „Welt-Chef“ von Google & Alphabet, Kent Walker, Agnes Heftbeger für Microsoft Deutschland oder Christopher d’Acry (E.ON) und Claudia Pohlink (Fiege Logistik). Aus der NRW-Politik dazu NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Ministerinnen Ina Brandes und Mona Neubaur. Wüst eröffnet mit einer deutlichen Botschaft: „KI kann für Deutschland zum wirtschaftlichen Game-Changer werden.

Die Zukunft beginnt jetzt – und NRW geht voran.“ Minsterin Neubaur betont: „Nordrhein-Westfalen hat den Wandel im Blut – von der Kohle zur KI.“ Ich bin überrascht über den Stand der Dinge und das Tempo von NRW beim Thema KI. Besonders beeindruckt hat mich die Klarheit, mit der viele Akteure nicht nur Chancen benennen, sondern auch Verantwortung übernehmen wollen – sei es für wirtschaftliche Innovation oder gesellschaftliche Verträglichkeit.

Was ich mitnehme, ist vor allem eines: Hoffnung darauf, dass wir nicht völlig hinter den Entwicklungen in China oder den USA zurückliegen. Mit einer konsequenten, gemeinsamen Strategie scheint es möglich, im KI-Rennen nicht nur aufzuholen, sondern eigene Maßstäbe zu setzen. Ich verlasse Berlin mit dem Gefühl, dass „Von der Kohle zur KI“ nicht nur eine kluge Formel ist – sondern eine echte Perspektive.
LÖFFELBANDE ZU GAST BEI MARCO ZINGONE

Seit 2017, nach seinem großen Triumph bei „The Taste“, richtet Marco Zingone diese exklusiven Abende der „Löffelbande“ mit anderen Erfolgsköchen der Sat1-Show aus. Mit von der Partie ist an diesem Abend die aktuelle Gewinnerin, die sympathische und zurückhaltende Katja Baum. Ich trete pünktlich um 19 Uhr in das Restaurant des Golfclubs Mülheim ein, und trotzdem gehöre ich dort zu meiner Verwunderung eher zu den späten Gästen. Wie immer ist der Abend komplett ausverkauft. Mich beeindruckt die liebevoll gestaltete Dekoration. Die Sitzordnung an hohen Tischen fördert die ausgezeichnete Stimmung und animiert dazu, auch mal den benachbarten Tisch zu besuchen und einen Plausch zu halten.
Das Besondere an den Löffelkreationen: Mit einem einzigen Happen schmeckt man das komplette Zusammenspiel aller Zutaten. Im Laufe des Abends folgen insgesamt sechs Löffel, die mich immer wieder aufs Neue überraschen. Ich frage die KI nach der Bedeutung mancher der ungewöhnlichen Zutaten. „Labnch“ zum Beispiel, erklärt uns die KI kurz: Ein cremiger, aus Joghurt hergestellter Frischkäse, der in der nahöstlichen Küche sehr beliebt ist. Und „Zhoug“? Das ist eine scharfe, grüne Sauce aus frischen Kräutern, Chili und Knoblauch – ein feuriger Genuss, der dem Gericht das gewisse Etwas verleiht. Danach warten noch zwei Gänge in traditionellen Portionen, besonders die Nudel in Trüffelsauce, einer meiner persönlichen Favoriten, zaubern ein Lächeln in mein Gesicht.

Kein Wunder also, dass sich das Format der Löffelbande etabliert hat und nun auf sein 10-jähriges Jubiläum zusteuert. Ich hoffe, ich darf dieses Event auch in Zukunft noch einmal miterleben.
RAVE BEI MCDONALD´S – BEATS, DRINKS UND EIN ABEND, DER ÜBERRASCHTE

Als Marcus Prünte, der McDonalds-Chef in Essen, mir erzählt, dass in seiner Filiale in Katernberg eine Rave-Party stattfindet, bin ich erst einmal irritiert. Zwar kenne ich ihn als jemanden mit Gespür für ungewöhnliche Ideen, aber eine Rave-Party in einem Schnellrestaurant? Ich kann mir das schwer vorstellen. Gerade deshalb sage ich zu. Am Abend selbst ist meine Skepsis schnell verflogen.
Ich erkenne den Gastraum kaum wieder: eine stimmige Inszenierung – dezente Spots, die mit den Beats harmonieren, und verschiedene Stationen für Drinks. DJ MBP übernimmt die musikalische Regie – seine Tracks sind ein echter Rave. Das Publikum – ein überraschend durchmischter Querschnitt: junge Menschen, TikToker, Clubgänger, aber auch ältere Semester wie ich. Und ich bin froh, dass ich nicht der Einzige außerhalb der GenZ bin.

Hinter dem Projekt steht die Eventagentur Aura. Zwischen zwei Tracks komme ich mit Giulia Wahn von Aura ins Gespräch. Sie erzählt mit leuchtenden Augen von ihrer Vision: Räume völlig neu denken, klassische Orte in temporäre Erlebnisräume verwandeln – für ein paar Stunden, mit klarer Botschaft. Es geht nicht darum, Clubs zu kopieren, sondern die Rave-Kultur dorthin zu bringen, wo man sie nicht erwartet. In der Menge entdecke ich bekannte Gesichter: Nicki Pistola, eine feste Größe in der Reality- und Social-Media-Welt, ist genauso unter den Gästen wie die TikTokerin @mariannastyle._ mit knapp 190.000 Followern. Doch es geht hier nicht um Sichtbarkeit, sondern um Atmosphäre. Niemand wird abgeschirmt, alle feiern gemeinsam – auf Augenhöhe. Ich gehe nach Hause mit dem klaren Gefühl, etwas miterlebt zu haben, das nachwirkt.
KI ALS CHANCE ODER RISIKO IN DER MEDIZIN MIT RICHARD D. PRECHT

Ich bin mittendrin – in einem spannenden Abend an der Universitätsmedizin Essen, der sich mit einer der drängendsten Fragen unserer Zeit beschäftigt: Ist künstliche Intelligenz in der Medizin eher Chance oder Risiko? Rund 300 Menschen sind gekommen. Auf dem Podium sitzt der Philosoph und Bestseller-Autor Richard David Precht, im Gespräch mit Prof. Jochen A. Werner als Vorstandsvorsitzendem der Universitätsmedizin Essen. Precht und Werner beleuchten die Licht- und Schattenseiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ich merke: Es gibt keine einfache Antwort. Die technologische Entwicklung bringt beides mit sich – Risiken und riesige Potenziale. Der zwischenmenschliche Umgang könnte sich durch KI verändern. Aber es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, vor allem für schwerkranke Menschen, für die jede Innovation einen Unterschied bedeuten kann. Zum Beispiel durch hochpräzise Operationsroboter – faszinierend, wie genau und sicher diese Technik schon heute funktioniert. Oder auch durch Virtual Reality, die Kindern während der Behandlung helfen kann, Ängste abzubauen und dem Klinikalltag zu entfliehen. Ich erlebe einen vielseitigen, klugen Austausch, der mir zeigt: Hier wird nicht nur über Technik gesprochen, sondern über echte Lösungen. Die Veranstaltung zeigt mir: Die Stiftung Universitätsmedizin bringt nicht nur Experten zusammen, sondern auch die, um die es wirklich geht – die Patientinnen und Patienten.
PREMIERE IN DER ESSENER LICHTBURG „KEEK´S LETZTES DING"

Als ich spontan von Daniel Jürgensen zur Premiere des Kurzfilms „Keek’s letztes Ding“ in der ehrwürdigen Essener Lichtburg eingeladen werde, lasse ich alles stehen und liegen. Eine einmalige Gelegenheit, die Macher und Schauspieler hautnah zu erleben. Für den neuen Kurzfilm mit Starbesetzung dient der Kultfilm „Bang Boom Bang“ aus 1999 als Basis für eine Aufklärung über Cannabis. Statt einem roten Teppich ist also passend ein grasgrüner ausgerollt. Ich bin hin und weg, als ich plötzlich mit Martin Semmelrogge, seiner Ehefrau Regine Prause und Familienhund vor der Fotowand posiere. Dabei auch Torsten Greif und Thomas Schatton, Inhaber der Firma Four 20 Pharma und als Hersteller medizinischer Cannabisprodukte Initiatoren des Films. Martin Semmelrogge begleitet meine Erinnerungen an TV und Kino von Kindesbeinen an. Von den „Vorstadt-Krokodilen“ aus 1977 über den legendären Film „Das Boot“ bis hin zum Kultstreifen „Bang Boom Bang“, in dem auch der Essener Dieter Krebs eine seiner letzten großen Rollen hatte. Oliver Korittke wird mir vorgestellt, Hauptdarsteller des neuen Kurzfilms und Sympathieträger aus „Bang Boom Bang“. Damals büßt Keek einen Daumen ein, als er einen Tresor knackt – also will ich spontan wissen: „Zeig mal beide Daumen – alle dran?“ Jawohl, alles dran. In „Keek’s letztes Ding“ verliert er als Rasenpfleger „nur“ seinen Job an einen Roboter und wittert im privaten Cannabis-Anbau das große Geschäft ...

MODEL VEIT ALEX (S)EINE INITIATIVE GEGEN MOBBING

Veit Alex – längst bekannt als androgynes Model und Stylist hat eine Geschichte als Mobbing-Opfer. Und genau darum hat er seine Initiative #VeitGegenMobbing ins Leben gerufen. Zu seinem 30. Geburtstag lädt er dafür zu einer Party ein – mit Lametta und Christmas-Songs, obwohl es eigentlich längst Frühling ist. Denn Weihnachten ist für ihn die Zeit, in der die Menschen lieb zueinander sind – so hat er es als Kind erlebt. Ich bin dabei. In der Divine Bar, tief in der Essener Innenstadt. Hier ruft Veit alle zusammen, um nicht nur ihn zu feiern, sondern vor allem #VeitGegenMobbing, das soll mehr sein als ein Hashtag: konkrete Hilfe bieten, zuhören, aufklären, stärken. Die Party ist Spendenaktion und Manifest zugleich – für mehr Respekt und echte Empathie, gegen Ausgrenzung und Schweigen. Darum spricht Veit über seine eigenen Mobbingerfahrungen. Ich spüre: keine Floskeln, keine Phrasen. Nur ehrliche Worte – und ein Blick, der tiefer geht.
Dann wird es emotional. Veit holt seine Eltern auf die Bühne. Zum ersten Mal steht er nach über einem Jahrzehnt internationaler Bühnenkarriere gemeinsam mit ihnen im Rampenlicht. Seine Stimme zittert ein wenig, als er sich bedankt. Mama Conny spricht mit feuchten Augen über die Wandlungsfähigkeit ihres Sohnes. Und Papa Peter? Der schnappt sich eine Gitarre und bringt mit einem leidenschaftlichen „Feliz Navidad“ die ganze Bar zum Mitsingen. Ich singe mit. Und merke: Das ist mehr als Musik. Das ist Verbindung. Insgesamt kommen an diesem Abend 11.111 Euro an Spenden zusammen – eine Zahl, die nicht nur symbolisch glänzt, sondern ganz konkret hilft.

Ich entdecke unter den Gästen viele bekannte Gesichter: Essens OB Thomas Kufen, Prof. Dr. Jochen Werner, Germany’s Next Topmodel-Finalistin Nicole Reitbauer, Reality-Star Jasmin Herren – sie alle sind gekommen, um Haltung zu zeigen. Ich stehe da, Glitzerblazer, Glas in der Hand, schaue mich um – und spüre: Das ist einer dieser Abende, die bleiben. Weil sie echt sind. Weil sie berühren. Und weil sie Mut machen.
NETZER – DIE SIEBZIGER JAHRE

Gemeinsam mit meinem Freund und Fußballfan Oliver Nöltge mache ich mich auf den Weg nach Dortmund ins Deutsche Fußballmuseum. Jimmy Hartwig begegnet uns mit seiner offenen, unglaublich sympathischen Art – ein Mensch, den man sofort ins Herz schließt. Toni Schumacher wirkt fit wie ein Turnschuh – energiegeladen und voller Lebensfreude. Günter Netzer, der große Star des Abends, wird von WDR2-Moderator Sven Pistor interviewt. In dem sehr persönlichen Gespräch erzählt er von den Erinnerungen an seine aktive Zeit: wie ihn sein Freiheitsdrang antrieb und wie er oft gegen Konventionen auf und neben dem Platz rebellierte – und wie wichtig die Freundschaften mit seinen Mitspielern für ihn bis heute sind. Von denen haben sich einige an diesem Abend eingefunden: Ich treffe Paul Breitner, Rainer und auch Manfred „Manni“ Kaltz. Sie alle gehören zu der Zeit, die die große Multimediashow über die Siebzigerjahre und eben Günter Netzer präsentiert. Am Ende ist Netzer hörbar überwältigt: „Ich bin erschlagen. Mein ganzes Leben in 25 Minuten – das hat mich tief berührt. Ich hätte nie gedacht, dass das alles so intensiv wieder hochkommt“. Den großen Spieler so emotional zu erleben, ist ein Moment, den ich nicht mehr vergessen werde. Die Ausstellung selbst ist ein wahres Fest für alle Sinne: Auf 1000 Quadratmetern tauche ich ein in Netzers Fußballwelt. Immersive Projektionen, emotionale Klänge, Originalschuhe und Trikots erzählen seine Geschichte. Ein Stück Fußballgeschichte wird lebendig, und uns packt die Nostalgie der Zeit, als wir als Kinder und Jugendliche mit unseren Idolen gefiebert haben. Gegen Ende der Veranstaltung treffe ich RWE-Urgestein Horst Hrubesch, der für die deutsche Nationalmannschaft die Bananenflanken von „Manni“ Kalz per Kopfball verwandelte. Eigentlich längst im Aufbruch befindlich, nimmt sich der Kopfballkönig kurz Zeit, sodass ich ihm meine Bewunderung ausdrücken kann und ein Selfie, das Autogramm der heutigen Zeit, mit ihm zustande kommt. Zum Abschied meine Bitte: „Herr Hrubesch, besuchen Sie uns bitte beim RWE!“

Dr. Richard Kiessler (Vorsitzender Stadtgespräche.ruhr), Sigmar Gabriel (ehem. Vizekanzler und Außenminister) und Gastgeber Sharyar Azhdari